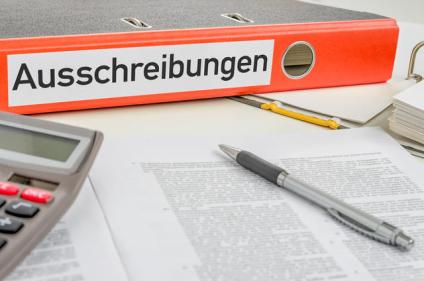Klimaatlas NRW - Newsletter Nr. 50
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Sie heute bereits zur 50. Ausgabe des Klimaatlas-Newsletters begrüßen zu können - ein kleines Jubiläum also. Diese "Jubiläumsausgabe" ist wieder gespickt mit vielen interessanten Informationen und Beiträgen.
Witterungstechnisch blicken wir noch einmal auf den März zurück, der der zweittrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Die große Trockenheit, die auch in der ersten Aprilhälfte anhielt, konnte in den vergangen beiden Wochen etwas gelindert werden, es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies nur ein kleines Zwischenspiel war.
Im "Einblick" können wir von den aktuellsten Entwicklungen im Klimaatlas berichten, hier konnten wir wieder einmal neue Daten und Karten integrieren und bestehende Rubriken (Konzepte vor Ort) aktualisieren. Auch die Projektlandkarte konnte um neue Projekte erweitert werden. Des Weiteren schauen wir auf die aktuellen Aktivitäten der Kommunalberatung und geben Ihnen ein Update zu den letzten Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring. Zusätzlich sucht das Fachzentrum Klima derzeit zwei "Data Scientisten".
Der "Rundblick" geht wieder einmal auf zahlreiche aktuelle Entwicklungen zur Klimaanpassung auf Landes-, Bundes- und auch europäischer Ebene ein. Darunter u. a. das bald anstehende Förderfenster der "DAS-Förderung", die neue Hochwasser-App des Landes NRW und aktuelle Entwicklungen bei unseren Partnerorganisationen, der Verbraucherzentrale und dem Landeszentrum Gesundheit. Darüber hinaus berichten wir über die neuesten Erkenntnisse des Copernicus-Programms zum Zustand des Klimas in Europa.
Im "Ausblick" erwarten Sie wie immer Hinweise zu ausgewählten Veranstaltungen, dabei z. B. auch die Erinnerung an unsere Anwenderschulung zum Klimaatlas, die am 13. Mai beim BEW in Essen stattfinden wird.
Wir wünschen Ihnen wie immer viele neue Erkenntnisse und eine gute Lektüre!
Ihr Klimaatlas- und Kommunalberatungsteam des Fachzentrum Klima des LANUK
-
Rückblick
-
Einblick
- Neue Daten und Aktualisierungen im Klimaatlas
- Neues von der Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW
- Weitere Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring
- Zwei Fachkräfte (w/m/d) Geoinformatik / Data Scientist im Fachzentrum Klima gesucht
-
Rundblick
- Neues Förderfenster der DAS-Förderung öffnet im Mai!
- Neue Starkregen- und Hochwasser App für NRW geht an den Start
- Programm „Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ geht in die dritte Runde
- BMUV fördert 100 neue Vorhaben zur Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen
- Der Klimakoffer der Verbraucherzentrale jetzt auch auf Instagram!
- Mehrsprachige Informationsmaterialien zum Hitze- und UV-Schutz jetzt verfügbar
- Erster Teil der VDI-Expertenempfehlung zur Hitzeaktionsplanung veröffentlicht
- Copernicus-Bericht zum Zustand des Klimas in Europa 2024 veröffentlicht
-
Ausblick
- BEW-Seminar "Basiswissen zu Hitzeaktionsplänen in Kommunen" am 07. Mai 2025, online
- Neues DAS-Förderfenster - Digitale Informationsveranstaltung zur Antragstellung am 13. Mai 2025, online
- Erinnerung: Nächste Anwenderschulung zum Klimaatlas beim BEW in Essen am 13. Mai 2025
- Konferenz: Klimaanpassung im Sport am 14. Mai 2025 in Berlin
- Online-Seminar: Entsiegelung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in Kommunen am 19. Mai 2025
- Infotage der bundesweiten Beratungsstelle zu den aktuellen Ausschreibungen des LIFE-Programms am 20. und 22. Mai 2025, online
- Klimaworkshop „Stadtplanung in Zeiten des Klimawandels - Maßnahmen und Modellierung“, am 24. Juni in Bochum
- Save the Date: Woche der Klimaanpassung vom 15.-19. September 2025
Rückblick
Warm, extrem trocken und sehr sonnig – der März 2025
Die aus den vergangenen Monaten bereits bekannte Hochdruckprägung setzte sich im März 2025 eindrücklich fort. Auch wenn es in Bezug auf die Temperaturen im vergangenen Monat noch keine besonderen Auffälligkeiten gab - es war weitgehend mild mit ersten frühlingshaft warmen Abschnitten, aber nicht außergewöhnlich - so macht die Niederschlagssituation bereits wieder erste Sorgen. Nur einmal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war ein März in NRW trockener als in diesem Jahr! Das führt nach dem schon deutlich zu trockenen Februar bereits jetzt dazu, in einer Phase, in der die Pflanzen viel Wasser für ihr Wachstum brauchen, dass die Bodenfeuchte deutlich abnimmt, Flusspegel sinken und es bereits zahlreiche Meldungen über erste Waldbrände gab. Die Trockenheit und z. B. auch die Waldbrandgefahr werden natürlich zusätzlich durch die Sonneneinstrahlung verstärkt und auch hier verzeichnete der März 2025 außergewöhnlich hohe Werte, die ihn ebenfalls auf Platz 2 der Rangliste führten.
Wie inzwischen üblich, lag die mittlere Lufttemperatur auch im März 2025 deutlich über dem Durchschnitt der Referenzperiode 1961-1990 (Abweichung: 2,5 Kelvin) sowie über dem der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 (Abweichung: 1,3 Kelvin) und das bereits im siebten Jahr in Folge. Damit landet der diesjährige März, knapp vor dem Jahr 2007, auf Rang 17 der wärmsten Märzmonate seit Beginn der Aufzeichnungen.
Lag die monatliche Niederschlagssumme im März des Vorjahres noch knapp unter den langjährigen Mittelwerten, war der März 2025 hingegen von extremer Trockenheit geprägt: Mit gerade einmal 10 l/m² im Landesdurchschnitt machten die Niederschläge dieses Monats lediglich einen Bruchteil des Mittelwertes von 1961-1990 (71 l/m²) sowie jenes von 1991-2020 (65 l/m²) aus. Der März 2025 ist somit nach dem Jahr 1929 der zweittrockenste März seit Aufzeichnungsbeginn!
Auch bei den Sonnenscheinstunden schaffte es der diesjährige März auf das Treppchen: mit stattlichen 213 Sonnenscheinstunden schien in NRW erstmals seit zwei Jahren wieder überdurchschnittlich lang die Sonne (1961-1990: 103 h; 1991-2020: 122 h). Der März 2025 belegt auch hier, hinter dem Jahr 2022, den zweiten Platz der sonnenscheinreichsten Märzmonate seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951.
Aufgrund der durchwegs milden Witterung wurden kaum temperaturbedingte Kenntage verzeichnet. An der Station Warstein wurden immerhin nochmal sechs Frosttage registriert, an der Kölner Station gab es im März 2025 keine kältebedingten Kenntage. Die Tagestiefsttemperaturen fielen an beiden Stationen rund 2 °C (VKTU) bzw. 3 °C (WAST) niedriger aus als im Vorjahr, im Gegensatz dazu die Tageshöchsttemperaturen um jeweils 3 bzw. 2 °C höher.
Alle Grafiken und Vergleichstabellen finden Sie wie gehabt im vollständigen Witterungsverlauf.
Einblick
Neue Daten und Aktualisierungen im Klimaatlas
Am 29.04.2025 wurden einige Neuerungen und Aktualisierungen im Klimaatlas eingespielt.
Zunächst ist das neue Handlungsfeld "Verkehr und Verkehrsinfrastruktur" zu nennen, das sich im Cluster "Planung und Bau" befindet. Dort haben wir drei neue Karten eingefügt, die auf wms-Diensten basieren:
- Böschungsbrandgefährdung an Schienenwegen
- Murgang- und Hangmurengefährdung an Schienenwegen
- Hangrutschungsgefährdung an Schienenwegen
Die Daten stammen aus Bundesstudien des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung und des Eisenbahn-Bundesamtes zur Gefährdung des Schienenverkehrsnetzes durch Böschungsbrände, Sturmwurf und gravitative Massenbewegungen. Ziel der Studien war die Erstellung von Gefährdungskarten, um auch unter dem Aspekt der Verstärkung des Risikos durch den Klimawandel, gezielt Maßnahmen und räumliche Priorisierungen zum Schutz der Schieneninfrastruktur ableiten zu können.
Darüber hinaus haben wir auch einige bestehende Karten aktualisiert. Hier sind zum einen die Karten zur "tatsächlichen forstlichen Vegetationszeit" im Handlungsfeld "Wald und Forstwirtschaft" zu nennen.
Bei diesen Karten wurden sowohl die Datengrundlage als auch die Berechnungsweise angepasst. Der DWD stellt nun HYRAS-Datensätze zu Lufttemperatur und Niederschlag im 1 km x 1 km - Raster zur Verfügung, so dass die Daten mit dieser guten Auflösung neu berechnet wurden. Dabei wurde die Berechnungsweise entsprechend dem Vorgehen des LANUV-Fachberichts 157 aktualisiert. D. h., dass nicht mehr pauschal alle Tage über der Temperaturschwelle von 10 °C gezählt werden, sondern Start- und Enddatum der Vegetationszeit entsprechend der Methodik von Hübener et al. 2017 pixelscharf bestimmt wird. Als Start- bzw. Enddatum wird das Über- bzw. Unterschreiten des Auftretens von sechs aufeinanderfolgenden Tagen mit der genannten Schwellentemperatur von 10 °C definiert (vgl. LANUV 2024). Dementsprechend wird auch die Karte der "Niederschlagssumme in der tatsächlichen forstlichen Vegetationszeit" nicht mehr anteilig aus Monatswerten berechnet, sondern anhand des Start-/Enddatums je Pixel. Hierbei werden, wie bereits erwähnt, aktualisierte Niederschlagstagesdaten (HYRAS Quelle) in 1-km²-Auflösung verwendet.
Dadurch ergeben sich deutlich genauere Daten, aber auch Unterschiede zur bisherigen Darstellungsweise. Bei der "tatsächlichen forstlichen Vegetationszeit" werden im NRW-Mittel leicht niedrigere Werte für die Dauer der Vegetationszeit berechnet, als beim alten Ansatz. Bei der "Niederschlagssumme in der tatsächlichen forstlichen Vegetationszeit" macht sich die methodische Änderung noch deutlicher bemerkbar: In Gebieten mit einer eher kurzen Vegetationszeit, wie im Hochsauerland, ist die Niederschlagssumme auch deutlich geringer als bisher. Dennoch ist davon auszugehen, dass insbesondere in den Mittelgebirgslagen im Durchschnitt ausreichend Niederschlag für die Wälder zur Verfügung steht.
Zum anderen wurde die Rubrik "Konzepte vor Ort" aktualisiert und erweitert.
In den Bereichen "Klimaanpassung auf Gemeindeebene" und "Klimaanpassung auf Landkreisebene" wurden die Karten aktualisiert. Außerdem gibt es bei beiden Verwaltungsebenen eine neue Karte zur "Hitzeaktionsplanung". Hierbei werden Kommunen aufgeführt, die einen Hitzeaktionsplan erstellt haben oder sich in der Erstellungsphase befinden bzw. sich mit der Hitzeaktionsplanung als Gesamtprozess befassen. Darüber hinaus konnten auf der Projektlandkarte zur kommunalen Klimaanpassung sieben neue Projekte aufgenommen werden.
Weiterhin gilt, teilen Sie uns gerne über klimaatlas@lanuk.nrw.de mit, wenn Ihre Kommune eine neue Karte oder Analyse erstellt hat bzw. sich im Erstellungsprozess befindet oder Sie ein spannendes Klimaanpassungsprojekt haben, das auf der Projektlandkarte aufgeführt werden sollte.
Neues von der Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW
Der sich nunmehr dem Ende entgegen neigende Monat April hat für das Team der Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW neben dem „Tagesgeschäft“ spannende Termine geboten. Ein kurzer Überblick soll die Bandbreite des Angebotsportfolios schildern:
Am 02.04.2025 fand erstmalig der Erfahrungsaustausch der Kreise in NRW zur Klimafolgenanpassung statt. Im Vorfeld hatten sich alle Kreise NRWs für die Teilnahme interessiert. Die Präsidentin des LANUK, Elke Reichert, begrüßte die Online-Sitzung, in der es vornehmlich um die künftige Ausgestaltung und Organisation des Vernetzungsangebots ging. Aber auch die erste Sitzung bot bereits Raum zum inhaltlichen Austausch. Die Kommunalberatung erarbeitet gerade das Konzept für die Durchführung weiterer Termine. Die Zielgruppe, die Klimaanpassungszuständigen in den Kreisverwaltungen von NRW, werden zur gegebenen Zeit mit Neuigkeiten versorgt.
Am 10.04.2025 führte das Team der Kommunalberatung zusammen mit dem Klimamanagement der Stadt Witten einen Workshop zur Verstetigung der Klimafolgenanpassung durch. Neben der Diskussion und Erarbeitung des aktuellen Umsetzungsstands der Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept, wurde gemeinschaftlich an einem gemeinsamen Verständnis zur Umsetzung von Maßnahmen, für die jeweiligen Verantwortlich- und Zuständigkeiten in den Fachämtern sowie für den ämterübergreifenden Austausch zur Klimaanpassung gearbeitet. Einen externen Input aus der Praxis lieferte hierfür Leif Pollex von der Stadt Gütersloh. Wenn auch Sie Bedarf an einem verwaltungsinternen Workshop haben, melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen gerne.
Ende März ist zudem bereits der bundesweite Entsiegelungs-Wettbewerb #abpflastern gestartet. Auch in NRW nehmen Kommunen daran teil, verknüpfen existierende Angebote damit oder nutzen die Gelegenheit, das Entsiegeln von Flächen zu thematisieren bzw. planen eine Teilnahme in der Zukunft. Zum Austausch von Erfahrungen und Ideen oder auch Herausforderungen lädt die Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW am 12.05.2025 ab 13:30 Uhr zu einem Online-Meeting ein. Interessierte Kommunen können sich per Mail an klimaatlas@lanuk.nrw.de wenden und die Zugangsdaten zur Teilnahme erhalten – herzliche Einladung hierzu!
Weitere Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring
Im April konnten erneut einige Indikatoren des Klimafolgen und Anpassungsmonitorings (KFAM) mit den neuesten Daten aktualisiert werden.
Dabei handelt es sich im Bereich "Klimaentwicklung" um die Indikatoren
- 1.1 Durchschnittliche Jahreslufttemperatur
- 1.2 Durchschnittliche Jahreszeitenlufttemperatur
- 1.3 Temperaturkenntage kalt (Frosttage, Eistage)
- 1.4 Temperaturkenntage warm (Sommertage, Heiße Tage, Tropennächte)
- 2.1 Durchschnittliche Jahresniederschlagssumme
- 2.2 Durchschnittliche Jahreszeitenniederschlagssumme
- 2.3 Starkniederschlags(kenn)tage
- 2.7 Schneetage und
- 3.1 Sonnenscheindauer
Im Handlungsfeld "Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz" um die Indikatoren
Im Handlungsfeld "Boden und Fläche" der Indikator
Im Handlungsfeld "Biodiversität und Naturschutz" die Indikatoren
- 6.5 Klimasensitive Pflanzenarten
- 6.6 Klimawandelbegünstigte invasive Pflanzenarten und
- 6.7 Temperaturindex der Vogelartengemeinschaft
Im Handlungsfeld "Wald- und Forstwirtschaft" der Indikator
Im Handlungsfeld "Verkehr und Verkehrsinfrastruktur" der Indikator
Zudem wurde im Handlungsfeld "Energiewirtschaft" der Indikator
aktualisiert.
Wir wünschen gute Erkenntnisse beim Nachvollziehen der neuesten Daten und Werte.
Zwei Fachkräfte (w/m/d) Geoinformatik / Data Scientist im Fachzentrum Klima gesucht
Das Fachzentrum Klimaanpassung, Klimaschutz, Wärme und Erneuerbare Energien schreibt zwei Stellen für Fachkräfte (w/m/d) Geoinformatik/Data Scientist zur Recherche, Aufbereitung und Einpflege von Daten in Geodatenbanken zu den Themen Klimaschutz, Erneuerbare Energien, kommunale Wärmeplanung und Monitoring der Energiewende NRW aus. Die Stellen sind befristet (4 Jahre) für die Entgeltgruppe 10 TV-L bis 11 TV-L ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 04.05.2025.
Die Aufgabenschwerpunkte liegen in den folgenden Bereichen:
Für die erste Stelle mit dem Schwerpunkt Wärmedaten:
- Auswertung, Bewertung und Monitoring der beim LANUK eingehenden kommunalen Wärmepläne
- Aufbereitung relevanter Daten für den Energieatlas mit Fokus auf Daten zur Wärmewende
- Fachliche Beratung von Kommunen und Bearbeitung von Datenanfragen zur kommunalen Wärmeplanung
Für die zweite Stelle mit dem Schwerpunkt Fachinformationssystem Energieatlas NRW:
- Pflege und Weiterentwicklung des Fachinformationssystems Energieatlas
- Unterstützung bei der Umstellung der Datenhaltung von GIS-Datenbanken auf PostGre/PostGIS
- Auswertung komplexer Daten zur Energiewende und ihre Aufbereitung für Veröffentlichungen
- Programmierung von automatisierten Datenabrufen
Alle weiteren Informationen zum gewünschten Profil, dem Ablauf des Bewerbungsverfahrens etc. finden Sie in der vollständigen Stellenausschreibung, welche Sie hier einsehen können.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungen!
Rundblick
Neues Förderfenster der DAS-Förderung öffnet im Mai!
Im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimwandels" (DAS) öffnet vom 15.05.2025 bis zum 15.08.2025 ein neues Förderfenster zu Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes und naturbasierten Lösungen.
In diesem Zusammenhang werden Mittel in Höhe von 10 Millionen Eüro über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundesumweltministeriums bereitgestellt. Damit sind auch wieder Anträge im Förderschwerpunkt A 1 (Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz, inkl. Klimaanpassungsmanagement) möglich.
Der Förderaufruf richtet sich gezielt an Kommunen. Diese erhalten im Rahmen des Förderaufrufs Zuschüsse von bis zu 90 Prozent der Finanzierungskosten für die Erarbeitung von Konzepten zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz durch Klimaanpassungsmanagerinnen und -manager, die sich insbesondere für mehr Nachhaltigkeit und natürlichen Klimaschutz einbringen sollen. Diese im Rahmen des ANK anzufertigenden Klimaanpassungskonzepte sollen die Synergien zwischen Klimaanpassung, natürlichem Klimaschutz und der Stärkung der Biodiversität besonders in den Fokus nehmen und insbesondere Maßnahmen unter Einsatz naturbasierter Lösungen entwickeln.
Die Förderung der Projekte erfolgt im Rahmen der Verfügbarkeit dieser Fördermittel.
Zur Unterstützung bei der Antragstellung organisiert die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) am 13.05.2025 für Interessierte eine digitale Veranstaltung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Veranstaltungsseite. Zur Anmeldung gelangen Sie hier.
Zusätzliche Informationen erhalten Sie in unserem Förder-Navi bzw. auf der Programmseite der ZUG.
Wenn Sie darüber hinaus Fragen zur DAS-Förderung oder der Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes haben, können Sie sich jederzeit gerne an die Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW wenden.
Neue Starkregen- und Hochwasser App für NRW geht an den Start
Seit einigen Jahren bereits kann jeder Bürger und jede Bürgerin des Landes seine individuelle Gefährung gegenüber Starkregen und Hochwasser im Handlungsfeld "Überflutung" des Klimaatlas NRW einsehen und einschätzen. Eine neue App erweitert diesen Service nun.
Seit dem 25. April 2025 ist die neue Webseite www.hochwasser-app.nrw freigeschaltet und auch als mobile Version für das Smartphone verfügbar. Mithilfe der Risikoerkennung kann schnell und einfach ermittelt werden, wie sicher das eigene Zuhause vor Überflutung, Starkregen oder Hochwasser ist. Die Risikoermittlung für das eigene Zuhause steht für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu Verfügung. Das neue Angebot stellt den erfolgreichen Start des landesweiten Roll-outs der ehemaligen FloodCheck-App dar.
118 von 396 Kommunen sind der Einladung gefolgt und präsentieren ihre Aktivitäten zu dem wichtigen Thema Starkregen- und Hochwasser-Risikomanagement. Dabei stellen die 118 Kommunen ihre Aktivitäten zur Überflutungsvorsorge dar, weisen auf eigene kommunale Starkregengefahrenkarten und zusätzliche Angebote hin und stellen einen Kontakt für Fragen bereit.
Ziel des digitalen Angebots ist es, den Bürgerinnen und Bürgern des Landes eine weitere Möglichkeit eines niedrigschwelligen, schnellen und unkomplizierten Zugriffs auf alle verfügbaren Informationen zur konkreten Gefährdungslage ihrer Immobilie zu ermöglichen. Der Starkregen- und Hochwasser-Check für das eigene Zuhause hilft, das persönliche Risiko einzuschätzen. Für das Angebot werden öffentlich zugängliche Daten im bzw. für das Land Nordrhein-Westfalen für den Roll-out verwendet: Dies betrifft Starkregenhinweiskarten, Hochwassergefahrenkarten und weitere Geoinformationen, die Sie weitgehend auch im Klimaatlas finden.
Nach Eingabe und Bestätigung der Adresse lassen sich verschiedene Varianten – von einem extremen bis außergewöhnlichen Starkregenereignis sowie unterschiedliche Hochwassersituationen – durchspielen. Angezeigt wird schematisch nicht nur, welche Flächen überflutet würden, sondern auch wie hoch das Wasser an dieser Adresse stehen würde. Möglich sind darüber hinaus auch drehbare 3-D-Ansichten eines Wohnobjektes. In Form eines Ampelsystems erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung der Immobilie bzw. des Grundstücks in Bezug auf Überflutungen durch Starkregen und durch Flusshochwasser. Die Bewertung kann als PDF heruntergeladen werden. Weitergehende Hintergrundinformationen zu den Gefahren durch Starkregen, Kanalrückstau, Flusshochwasser und Grundhochwasser sowie zu den kommunalen Ansprechpersonen runden das Beratungsangebot ab.
Programm „Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ geht in die dritte Runde
Ob die Errichtung eines Schul- oder Gemeinschaftsgartens, die Schaffung eines Begegnungsortes für Umweltbildung oder die Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit – der freiwillige Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern leistet einen enormen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz und für eine nachhaltige Mobilitätswende. Um dieses bürgerschaftliche Engagement zu fördern, startet das Umwelt- und Verkehrsministerium NRW die dritte Runde des Programms „Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements".
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen können sich bis zum 30. Juni 2025 bewerben. Dafür beschreiben sie ihre Ideen in einer Projektskizze und machen deutlich, wofür sie fachliche Beratung benötigen. Das Ministerium prüft die eingereichten Vorschläge und trifft anhand fachlicher Kriterien eine Auswahl. Die ausgewählten Initiativen werden von einem Beratungsbüro über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten bei der Umsetzung ihrer Ideen begleitet.
Mit dem Programm zur „Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ unterstützt das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV) Projektideen von Vereinen, Initiativen, Einzelpersonen und gemeinwohlorientierten Unternehmen in den Themenfeldern:
- Naturschutz, Biodiversität, Artenschutz
- Nachhaltige Entwicklung, sozial-ökologische Transformation
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Umweltbildung
- Anpassung an den Klimawandel, Natürlicher Klimaschutz
- Klima- und Umweltschutz im Verkehr
- Mobilität der Zukunft, Rad- und Fußverkehr, Verkehrssicherheit
- Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, Abfallvermeidung
- Umweltwirtschaft
- Wasserwirtschaft und Bodenschutz
- Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projektseite des PTJ.
BMUV fördert 100 neue Vorhaben zur Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen
Das Bundesumweltministerium unterstützt über das Förderprgramm Anpassung in Sozialen Einrichtungen (AnPaSo) 100 soziale Einrichtungen mit fast zwölf Millionen Euro, um sich besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Gefördert werden vor allem Maßnahmen wie Gründächer, Fassadenbegrünungen und die Schaffung von Wasserflächen, die sowohl den Klimaschutz stärken als auch den Menschen in Einrichtungen wie Kindergärten, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen zugutekommen. Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern Schutz vor extremen Wetterbedingungen wie Hitzewellen und Starkregen zu bieten. Die Maßnahmen sollen als Vorbilder dienen und andere Einrichtungen dazu anregen, ähnliche Klimaanpassungsprojekte umzusetzen.
Im Fokus stehen dabei Klimaanpassungskonzepte und Vorhaben, die naturbasierte Maßnahmen, wie Gründächer und Fassadenbegrünungen, die Entsiegelung von Flächen oder die Anlage von Wasserflächen, zur Anwendung bringen. Sie dienen der Klimaanpassung und zugleich dem natürlichen Klimaschutz, der Biodiversität, dem Speichern von Regenwasser, der Verbesserung der Luftqualität sowie dem Lärmschutz.
Die geförderten Projekte sollen einen ausgeprägten Modellcharakter haben und andere Akteure mittels bestehender Netzwerke zur Nachahmung anregen. Die Anträge im aktuellen Förderfenster sehen zum Beispiel Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünungen zur Verringerung der Hitzebelastung in Gebäuden vor, aber auch innovative Ansätze zur Regenwasserversickerung wie die Ausbildung von Spielmulden mit Retentionsfunktion im Außenbereich einer Kindertagesstätte.
Hier gehts zur Programmseite.
Der Klimakoffer der Verbraucherzentrale jetzt auch auf Instagram!
Der Klimakoffer der Verbraucherzentrale NRW ist ein digitaler (Werkzeug-)Koffer und steht für eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung von Werkzeugen, die Verbraucherinnen und Verbraucher auf Ihrer persönlichen Reise zur Anpassung an den Klimawandel begleiten.
Seit kurzem ist der Klimakoffer auch auf Instagram vertreten. Die Verbraucherzentrale lädt Sie ein, den Bürgerinnen und Bürgern in Ihrer Kommune davon zu berichten, damit diese den Auftritt besuchen. Folgen Sie aber auch gerne selbst.
In den sozialen Medien (Facebook & Instagram) werden fachlich fundierte Informationen zu den Themen Begrünung, Entsiegelung, Schutz vor Starkregen und Regenwassernutzung geboten. Die Auftritte finden Sie nachfolgend:
Nach einem aktionsreichen Jahresauftakt geht auch das Veranstaltungsprogramm weiter. Die Angebote der Verbraucherzentrale für Verbraucherinnen und Verbraucher finden Sie auf https://www.klimakoffer.nrw/veranstaltungen. Das Beratungsangebot zur Dachbegrünung, Starkregenvorsorge und zur Nutzung von Regenwasser erreichen Sie hier: https://www.klimakoffer.nrw/klimaanpassung-beratung.
Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich, wenn Bürgerinnen und Bürger aus allen Städten und Gemeinde des Landes die Angebote nutzen.
Mehrsprachige Informationsmaterialien zum Hitze- und UV-Schutz jetzt verfügbar
Im Frühjahr 2025 hat das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) mehrsprachige Flyer und Poster entwickelt, um die gesundheitsbezogene Kommunikation zu Hitze- und UV-Schutz in Nordrhein-Westfalen weiter zu stärken. Die Materialien richten sich an die Allgemeinbevölkerung und stehen in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Arabisch, Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch und Türkisch.
Die neuen Informationsmaterialien umfassen einen Flyer sowie drei Poster, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Hitze- und UV-Schutzes thematisieren:
- Der Flyer „Sonne. Hitze. Schutz! Tipps für heiße Tage“ enthält kompakte Empfehlungen zum Verhalten bei Hitze – zu Hause, unterwegs, in Bezug auf Kleidung, Ernährung und den Umgang mit Medikamenten.
- Die Poster bereiten zentrale Inhalte visuell und leicht verständlich auf:
- „Sicher unterwegs an heißen Tagen“ – Tipps zum Schutz vor Hitze und UV-Strahlung im Freien
- „Kühl bleiben an heißen Tagen“ – Empfehlungen zum Hitzeschutz in den eigenen vier Wänden
- „Zusammen stark an heißen Tagen“ – Hinweise, wie man sich gegenseitig bei Hitze unterstützen kann
Alle Materialien sind mit anschaulichen Illustrationen und Piktogrammen gestaltet. Der Flyer eignet sich sowohl für die digitale Nutzung als auch für den Druck, während die Poster vorrangig für den Druckeinsatz vorgesehen sind. Die Druckversionen lassen sich bei Bedarf individualisieren – zum Beispiel mit dem eigenen Logo, Kontaktdaten und einem kurzen Text. Eine Anleitung zur Individualisierung steht ebenfalls zur Verfügung.
Die Materialien stehen ab sofort unter www.lzg.nrw.de/hitzeinfo zum Download bereit. Bei Rückfragen oder Unterstützungsbedarf zur Anpassung der Materialien wenden Sie sich gerne an klima@lzg.nrw.de.
Erster Teil der VDI-Expertenempfehlung zur Hitzeaktionsplanung veröffentlicht
Seit dem (ersten) Jahrhundertsommer 2003, der in Mitteleuropa zu einer hohen Zahl an hitzebedingten Todesfällen geführt hat, treten in Mitteleuropa immer wieder solche Extremwetterereignisse auf. In den letzten Jahren beschäftigen sich auch immer mehr Kommunen sehr intensiv mit Fragen zum Umgang mit extremer sommerlicher Hitze und der Umsetzung von Maßnahmen, um deren Auswirkungen zu reduzieren.
Im April wurde mit der Veröffentlichung des Blatt 13 der VDI-Richtlinie 3787 als VDI-Expertenempfehlung begonnen, das sich mit der Hitzeaktionsplanung beschäftigt. Ziel der Richtlinie ist es daher den Kommunen einen standardisierten Handlungsrahmen zum möglichen Vorgehen im Umgang mit Hitzeereignissen und in einer auf Prävention ausgerichteten Hitzeaktionsplanung aufzuzeigen. Blatt 13 gliedert sich in drei Teile (Beiblätter), wovon nun Teil 13.1 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung der Beiblätter 13.2 und 13.3 ist für den Juni 2025 vorgesehen.
Die VDI-EE 3787 Blatt 13 enthält folgenden Kernelemente (die Nummerierung der Kernelemente richtet sich dabei nach der Handlungsempfehlung des BMUB (2017)):
- Zentrale Koordinierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit (13.1)
- Nutzung des Hitzewarnsystems (13.1)
- Information und Kommunikation (13.1)
- Reduzierung von Hitze in Innenräumen (13.3)
- Besondere Betrachtung von Risikogruppen (13.2)
- Vorbereitung der Gesundheits- und Sozialsysteme (13.2)
- Langfristige Stadtplanung und Bauwesen (Sammlung von Hinweisen und Verweisen zu im Kontext stehenden, existierenden Richtlinien, Normen und Standards) (13.3)
- Monitoring und Evaluierung der Maßnahmen. (13.1)
In der VDI-EE werden kurz-, mittel- und langfristige Anpassungsmaßnahmen für einen nachhaltigen hitzebezogenen Gesundheitsschutz beschrieben. Darüber hinaus wird auf die Bedeutung der interdisziplinären und fachübergreifenden Zusammenarbeit der verschiedenen kommunalen Fachstellen und der Notwendigkeit einer zentralen Koordination hingewiesen. Weitere Elemente der Richtlinie beschreiben den Ablauf von der Hitzewarnung bis zur Information der und Kommunikation mit der Bevölkerung bis hin zu einem kontinuierlichem Monitoring und Evaluation der Hitzeaktionsplanung. Weitere Elemente werden in den nächsten Beiblättern folgen.
Copernicus-Bericht zum Zustand des Klimas in Europa 2024 veröffentlicht
Am 15. April veröffentlichten der Copernicus Climate Change Service (C3S) - der Klimadienst der Europäischen Union und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) den neuen Bericht zum Stand des Klimas in Europa, der für 2024 erneut zahlreiche neue Rekorde dokumentiert. Erstmals wurde im globalen Mittel der im Pariser Klimaabkommen festgelegte Temperaturanstieg von 1,5 °C überschritten. In Europa erreichte die Zahl der Hitzestress-Tage den zweithöchsten Wert, während beim Kältestress ein Negativrekord mit den wenigsten Tagen verzeichnet wurde und die Fläche mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weiter abnahm. Auch die Oberflächentemperaturen der europäischen Gewässer und des Mittelmeers erreichten neue Höchstwerte. Die Gletscher in Skandinavien und auf Spitzbergen verzeichneten die größten Masseverluste weltweit.
Der Kontinent erlebte im Jahr 2024 allgemein einen ausgeprägten West-Ost-Kontrast. Während Osteuropa von außergewöhnlich sonnigem und trockenem Wetter geprägt war, das maßgeblich zur erhöhten Durchschnittstemperatur beitrug, erlebte Südosteuropa zudem die bislang längste Hitzewelle. In Westeuropa hingegen war das Jahr eines der zehn nassesten seit 1950, begleitet von den am weitesten verbreiteten Überschwemmungen seit 2013. Dort lagen die Temperaturen teils sogar unter dem Durchschnitt.
Des Weiteren sticht hervor, dass sich der europäische Kontinent im globalen Vergleich am stärksten erwärmt, wenn man die absoluten Temperaturen betrachtet. Laut Klimaforschern liegt dies vor allem an den abnehmenden Niederschlägen, die zu trockeneren Böden führen und dadurch die Erwärmung zusätzlich verstärken. Allerdings sind die Auswirkungen des Temperaturanstiegs in anderen Regionen der Welt, wie etwa in den Tropen, häufig noch gravierender spürbar.
Positiv ist hervorzuheben, dass 2024 bereits 45 % der Elektrizität in Europa aus erneuerbaren Energien erzeugt wurden.
Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Bericht oder der kompakten Zusammenfassung (beides auf Englisch) auf der offiziellen Copernicus-Webseite.
Ausblick
BEW-Seminar "Basiswissen zu Hitzeaktionsplänen in Kommunen" am 07. Mai 2025, online
Sie wollen den Hitzeschutz in Ihrer Kommune systematisch angehen? Dann ist ein Hitzeaktionsplan (HAP) ein wirksames Instrument!
Die mit dem Klimawandel einhergehende Intensität und Häufigkeit extremer Hitzeereignisse stellt ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung dar. Urbane Ballungsräume sind besonders von diesen betroffen. Die Integration von Hitzevorsorge in die Agenda von Städten und Kommunen ist ein wichtiger Schritt, um die Resilienz gegenüber extremen Wetterbedingungen zu stärken und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
Als Kommune definieren Sie die Zuständigkeiten, Aufgaben und Kommunikation zwischen den kommunalen Akteuren. Neben den vorausschauenden, langfristigen Anpassungsmaßnahmen eines aktuellen Klimafahrplans enthält der Hitzeaktionsplan wichtige Sofortmaßnahmen. Die Wirksamkeit eines Hitzeaktionsplans hängt aber auch davon ab, wie Sie Ihre Bürger und Bürgerinnen mitnehmen und einbinden können.
Dieses Online-Basisseminar am Mittwoch, den 07. Mai 2025 von 09:30 - 12:45 Uhr vermittelt den Teilnehmenden die wissenschaftlichen Grundlagen, Arbeitshilfen und Best-Practice-Beispiele für den eigenen Hitzeaktionsplan. Hierbei werden Themen wie gesundheitliche Auswirkungen von Hitze, Informationssysteme und die Berücksichtigung von Hitze in der Gesundheitsplanung behandelt.
Hier gehts zur Veranstaltungsseite mit der Möglichkeit sich anzumelden.
Neues DAS-Förderfenster - Digitale Informationsveranstaltung zur Antragstellung am 13. Mai 2025, online
Die Veranstaltung am 13. Mai 2025 von 10:00 - 12:00 Uhr bietet Informationen zum neuen ANK-DAS-Förderaufruf im Rahmen der Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS) - siehe oben. Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die Förderrichtlinie, die Fördervoraussetzungen sowie den Ablauf des Antragsverfahrens. Im Anschluss an die Präsentationen besteht die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen.
Das Förderfenster und damit die Veranstaltung, richtet sich an Kommunen, die ein Klimaanpassungskonzept im Förderschwerpunkt A.1 entwickeln möchten. Der Aufruf wird aus Mitteln des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) finanziert und ist vom 15. Mai bis 15. August 2025 geöffnet.
Die Anmeldung ist über die Veranstaltungsseite der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) möglich.
Erinnerung: Nächste Anwenderschulung zum Klimaatlas beim BEW in Essen am 13. Mai 2025
Am Dienstag, den 13. Mai 2025 wird zudem die nächste Anwenderschulung zum Klimaatlas NRW wie gewohnt von 9:30 Uhr - 15:00 Uhr beim BEW in Essen stattfinden.
Dabei werden erneut die einzelnen Funktionen, Handlungsfelder und Tools des Klimaatlas sowie die damit verbundenen Nutzungsmöglichkeiten detailliert vorgestellt und anhand von praktischen Beispielaufgaben durch die Teilnehmenden angewendet.
Seien Sie dabei und nutzen Sie die Möglichkeit den Klimaatlas in seinen Details besser kennenzulernen!
Die Anmeldung zur Anwenderschulung ist über diesen Link möglich.
Konferenz: Klimaanpassung im Sport am 14. Mai 2025 in Berlin
Die Konferenz "Klimaanpassung im Sport", die am 14. Mai 2025 von 10:00-17:00 Uhr im Umweltbundesministerium in Berlin stattfindet, widmet sich den Auswirkungen des Klimawandels auf den Sport und den damit verbundenen Anpassungsmaßnahmen. Starkregen, Hitze und Wassermangel betreffen zunehmend Sportlerinnen und Sportler, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten. Die Veranstaltung beleuchtet, wie die Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel für Sportlerinnen und Sportler minimiert werden können und welche baulichen sowie technischen Anpassungen an Sportstätten erforderlich sind, um den Betrieb unter klimatischen Veränderungen aufrechtzuerhalten.
Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden zusammenkommen, um die aktuellen Herausforderungen und Chancen im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sportstätten zu diskutieren. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bundesumweltministerium ausgerichtet.
Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.
Online-Seminar: Entsiegelung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in Kommunen am 19. Mai 2025
Wie kann Entsiegelung in Kommunen umgesetzt werden? Im Fokus dieses Online-Seminars am 19. Mai 2025 von 13:00 - 16:00 Uhr des Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz (KNK) stehen praxisorientierte Hinweise zur Entwicklung und Umsetzung von Entsiegelungskonzepten, um natürliche Bodenfunktionen wiederherzustellen.
Die Versiegelung im urbanen Raum nimmt vielerorts weiter zu, sei es durch Asphalt, Beton oder Pflaster, durch Bebauung oder starke Verdichtung des Oberbodens. Dies beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität, sondern verhindert auch essenzielle Ökosystemleistungen des Bodens. Versiegelte Flächen verstärken Hitzebelastung, beeinträchtigen die Wasseraufnahme, mindern die biologische Vielfalt und reduzieren die Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung und -bindung.
Kommunale Entsiegelungskonzepte sind ein Schlüssel zu nachhaltiger Stadtentwicklung. Entsiegelungsmaßnahmen sollten vor allem darauf abzielen, die natürlichen Bodenfunktionen wiederherzustellen. Durch den Aufbau oberer Bodenschichten kann mehr Wasser gespeichert und in der Fläche gehalten werden, die Kühlfunktion reaktiviert, Lufttrockenheit reduziert und wertvoller Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten zurückgewonnen werden.
Im Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ können die Erstellung von Entsiegelungskonzepten und Entsiegelungsmaßnahmen bis zu 90% gefördert werden. In diesem Onlineseminar informiert die KfW über diese Fördermöglichkeit im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK). Fachexpertinnen und -experten geben Einblicke
- in die theoretische Entwicklung von Konzepten,
- in zu erfüllende Mindestanforderungen sowie
- in die praktische Umsetzung von Entsiegelung.
Das Seminar richtet sich u. a. an Kommunen, Stadt- und Landschaftsplanerinnen und -planer sowie Ingenieurbüros und soll diese bei ihren Vorhaben unterstützen.
Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Veranstaltungsseite.
Infotage der bundesweiten Beratungsstelle zu den aktuellen Ausschreibungen des LIFE-Programms am 20. und 22. Mai 2025, online
Am 24. April 2025 wurden die diesjährigen Ausschreibungen im Rahmen des EU LIFE-Programms veröffentlicht. Dazu finden vom 13. bis 15. Mai die #EULIFE25 INFO DAYS der europäischen Agentur CINEA in englischer Sprache statt. Anschließend lädt die deutsche LIFE-Beratungsstelle am 20. und 22. Mai 2025 zu den deutschsprachigen, digitalen Infotagen ein.
Die Infotage bieten Gelegenheit, LIFE und die bundesweite Beratungsstelle kennenzulernen sowie von Expertinnen und Experten der EU und aus Deutschland Informationen zu den aktuellen Fördercalls zu erhalten. Am 20. Mai stehen von 09:00 - 15:00 Uhr sowohl die Ausschreibungen im Allgemeinen als auch die spezifischen Besonderheiten der Teilprogramme Naturschutz und Biodiversität (NAT), Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität (ENV) sowie Klimaschutz und Klimaanpassung (CLIMA) im Fokus. Am 22. Mai erhalten Sie Infos zu den Calls im Teilprogramm Energiewende und Energieeffizienz (CET). Die Infotage beinhalten Hinweise aus der Projektpraxis sowie Beispiele erfolgreicher LIFE-Projekte.
Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.
Klimaworkshop „Stadtplanung in Zeiten des Klimawandels - Maßnahmen und Modellierung“, am 24. Juni in Bochum
Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des dritten Bürostandortes der Lohmeyer GmbH im Ruhrgebiet (Bochum) - lädt diese zum Klimaworkshop „Stadtplanung in Zeiten des Klimawandels - Maßnahmen und Modellierung“ ein.
Dieser findet am Dienstag, dem 24. Juni 2025, in Bochum am Rande des Stadtparks im Parkhotel statt. Es wird ein interessantes Programm, das sich mit dem Stadt- bzw. Lokalklima befasst, geboten. Dabei wird sich mit den klimatischen Verhältnissen in der Stadt, ihrer zukünftigen Veränderung und den Anpassungserfordernissen befasst, die damit verbunden sind.
Außerdem soll ein Blick auf städtebauliche Entwicklungen unter Berücksichtigung des Klima(wandel)s innerhalb verschiedener Planungsebenen geworfen werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Modellierung des Stadt- und Lokalklimas mit Hilfe des Stadtklimamodells PALM-4U.
Der Workshop ist eine gute Gelegenheit für Vertreter aus Kommunen und Behörden, Planungs-/Ingenieurbüros sowie der Forschung, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.
Weitere Informationen, das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.lohmeyer.de/workshop2025.
Save the Date: Woche der Klimaanpassung vom 15.-19. September 2025
Die Woche der Klimaanpassung (WdKA) geht vom 15.-19.09.2025 in die nächste Runde und steht alljährlich unter dem Motto „Gemeinsam für Klimaanpassung“. Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) führt das Zentrum KlimaAnpassung die WdKA durch, um der Klimaanpassung in Deutschland mehr Sichtbarkeit und Gewicht zu geben.
Das kann nur dann gelingen, wenn der Klimaanpassung gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren aus allen gesellschaftlichen Bereichen und ihrem Wissen, Erfahrungsschatz und Engagement eine angemessene Präsenz verliehen wird.
Ziel der WdKA ist es, die Vielzahl der engagierten Institutionen und Akteure öffentlichkeitswirksam sichtbar zu machen. Verbreiten Sie die Information in Ihrem Wirkungskreis und rufen Sie dazu auf, sich an der Woche der Klimaanpassung mit einer Veranstaltung/Aktion oder einem Beispiel guter Praxis zu beteiligen, entweder vor Ort oder online. Ob als Vortrag, Konferenz, Klimaspaziergang, Workshop, Webinar, Quiz, aktuelle Publikation, Tag der offenen Tür oder Stand auf dem Marktplatz - die Bedeutung, Vielfalt und Dynamik der Klimaanpassung auf allen Ebenen kann auf unterschiedlichsten Wegen vermittelt werden.
Mitmachen können alle, die Klimaanpassung umsetzen, planen, fördern oder dazu beraten und informieren.
Ab sofort steht unter www.zentrum-klimaanpassung.de/wdka25 eine Online-Plattform zur Verfügung, in der Sie eigenständig Ihre Aktionen, Veranstaltungen oder auch Beispiele guter Praxis eintragen können. Registrieren Sie sich hier!
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an wdka@zentrum-klimaanpassung.de.