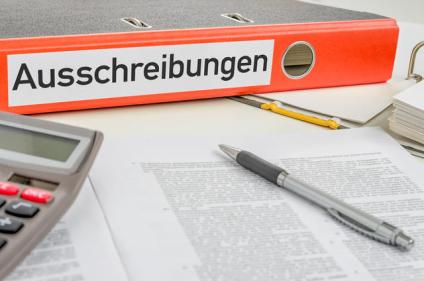Klimaatlas NRW - Newsletter Nr. 49
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir begrüßen Sie zur neuen Ausgabe des Klimaatlas Newsletters. In dieser erhalten Sie wieder zahlreiche Informationen rund um den Themenbereich Klimawandel und Klimfolgenanpassung.
Während der Frühling Fahrt aufnimmt und auf Bundesebene die politischen Weichen neu gestellt werden und das neue "Sondervermögen" Hoffnung auf entsprechende Weiterentwicklungen auch im Themenkomplex Klimaschutz und Klimafolgenanpassung bringt, wird es bei uns im LANUV in der kommenden Woche eine historische Veränderung geben. Nach 18 Jahren unter diesem Namen wird zum 1. April 2025 aus dem LANUV NRW das LANUK NRW und das ist kein Aprilscherz! Alle Hintergründe dazu lesen Sie im "Einblick". Dort finden Sie zudem einen Rückblick auf die Mittelgebirgskonferenz am 12. März, einen Ausblick auf die nächste Anwenderschulung zum Klimaatlas im Mai, die neuesten Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring sowie eine aktuelle Stellenausschreibung unserer Kolleginnen und Kollegen des Fachbereich 34.
Zuvor blicken wir selbstverständlich noch einmal auf die Witterung im Februar und die Auswertung des Winters 2024/2025 zurück. Auffällig war hier insbesondere, dass der Februar sehr trocken war, wodurch die sehr nasse Phase seit dem Spätsommer 2023 zunächst einmal zumindest unterbrochen wurde. Ansonsten gab es in den letzten Monaten viel Durchschnitt zu verzeichnen.
Im "Rundblick" weisen wir auf die Wiederaufnahme und Ausweitung der Förderung "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" (NKK) hin und berichten zudem vom einem großen, bei Köln geplanten Überflutungsraum, der für den Hochwasserschutz am Rhein einen großen Mehrwert bringen wird. In Paris wurde am vergangenen Wochenende darüber abgestimmt 500 Straßen klimagerecht umzugestalten. Dass die Umgestaltung des Straßenraumes im Zuge des Klimawandels auch hierzulande ein zunehmend wichtiges Element darstellt, beweisen die beiden Meldungen zu den Projekten LesSON und Blue Green Streets. Darüber hinaus erhalten Sie hier wieder einmal einige Informationen zu neuen interessanten Publikationen.
Im "Ausblick" erwarten Sie wie immer Hinweise auf Veranstaltungen in der nahen und mittleren Zukunft, aber auch bereits einen ersten Hinweis auf eine Fachkonferenz im UBA im September.
Aber lesen Sie selbst, wir wünschen Ihnen dabei wie immer eine gute Lektüre!
Ihr Klimaatlas- und Kommunalberatungsteam des Fachzentrum Klima des LANUV
-
Rückblick
- Deutlich zu trocken – der Februar 2025
- Trotz Durchschnittlichkeit insgesamt wenig winterlich – der Winter 2024/25
-
Einblick
- Aus dem LANUV wird zum 1. April 2025 das LANUK
- Rückblick auf die Mittelgebirgskonferenz 2025
- Neue Anwenderschulung zum Klimaatlas beim BEW in Essen terminiert
- Weitere Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring
- Stellenausschreibung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
-
Rundblick
- Natürlicher Klimaschutz in Kommunen: Neustart und Erweiterung des BMUV-Förderprogramms
- Genehmigung für größte Hochwasserschutz-Maßnahme: Gesteuerter Überflutungsraum bei Köln-Worringen entlastet am Rhein
- Onlinekurs für Kommunalverwaltungen: Wuppertal Institut veröffentlicht kostenfreies E-Learning für die nachhaltige Gestaltung lebenswerter Straßen
- Vorstellung des Forschungsberichts "BlueGreenStreets 2.0: implementieren, evaluieren, verstetigen"
- Zwei neue Publikationen des Umweltbundesamtes zur Klimaanpassung veröffentlicht
- KLUG veröffentlicht neuen Musterhitzeschutzplan für den Rettungsdienst
- Ergebnisse des Forschungsprojektes "Strategien für klimagerechte Dachflächen"
-
Ausblick
- ZKA Spezial: Klimaangepasste Gebäude: Vorsorgen für Hitze und Starkregen am 08. April 2025, online
- NKU-Sprechstunde „Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel und ihre Bedeutung für Unternehmen" am 10. April 2025, online
- Zukunftsgewässer NRW: Kooperation Überflutungsvorsorge an Agger und Wupper am 30. April 2025, online
- Klima und Starkregen - Strategien und Herausforderungen: Neue BEW-Seminarreihe im Mai, Präsenz in Essen und online
- Bundeskongress Zukunftsfähige Schulgelände am 14. und 15. Mai 2025 in Berlin
- Copernicus im Einsatz: Planung und Steuerung einer klimaresilienten Stadtentwässerung und Wasserwirtschaft am 03. und 04. Juni 2025 beim RVR in Essen
- Save the Date: Klimawandelanpassung im Blick - welche Fortschritte machen wir? am 16. und 17. September 2025 in Dessau
Rückblick
Deutlich zu trocken – der Februar 2025
Der Februar 2025 war überwiegend von Hochdruck geprägt. Das führte letztlich dazu, dass insbesondere die Niederschlagsbilanz in NRW seit längerer Zeit erstmals wieder deutlich unterdurchschnittlich ausfiel. Ebenfalls durch die verbreitete Hochdruckwetterlage bedingt, herrschten insbesondere in der ersten Monatshälfte eher kalte Temperaturen vor, bevor das Temperaturniveau in der letzten Februarwoche deutlich anstieg und zum Teil recht hohe zweistellige Temperaturwerte brachte. Unterm Strich lag der Februar daher letztlich im für die aktuelle Klimanormalperiode 1991-2020 normalen Bereich, sprich, knapp über dem Durchschnitt, und entsprechend deutlicher über dem Durchschnitt der Referenzperiode 1961-1990. Im Unterschied zu den Vormonaten bedeutet Hochdruck im Februar, aufgrund des bereits wieder höheren Sonnenstandes, nicht mehr automatisch auch neblig-trübes Wetter, so dass auch die Sonnenscheinstunden in diesem Jahr deutlich überdurchschnittlich ausfielen.
Der Februar 2025 fiel mit einer durchschnittlichen Temperatur von 3,0 °C zwar deutlich kühler aus als im Vorjahr, lag aber bereits zum siebten Jahr in Folge über dem Mittelwert der Referenzperiode 1961-1990 (Abweichung: +1,2 K) sowie, wenn auch nur knapp, über dem der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 (Abweichung: +0,2 K). Somit landete der diesjährige Februar lediglich im oberen Mittelfeld der beobachteten Zeitreihe seit Messbeginn 1881.
Entgegen dem allgemeinen Trend des Vorjahres fiel der Februar in diesem Jahr deutlich zu trocken aus. Mit einer Niederschlagssumme von lediglich 20 l/m² im Landesdurchschnitt wurden sowohl die Referenzperiode 1961-1990 als auch die aktuelle Klimanormalperiode 1991-2020 um jeweils ungefähr zwei Drittel unterboten. Dabei fiel in einigen Landesteilen gut die Hälfte des Monatsniederschlags an einem einzigen Tag, nämlich dem 26. Februar. Der Februar 2025 belegt damit in der Rangliste immerhin Platz 16 der niederschlagsärmsten Februarmonate seit Beginn der Aufzeichnungen.
Die überwiegende Hochdruckprägung brachte auch zahlreiche Sonnenscheinstunden in NRW: mit einer Summe von 88 Sonnenstunden schien in diesem Februar länger die Sonne als im 30-jährigen Mittel der Referenzperiode 1961-1990 sowie der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 mit jeweils 72 Sonnenscheinstunden. Dieser Februar belegt ebenfalls Platz 16 der sonnenscheinreichsten Februare seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1951.
Weder in Köln noch in Warstein konnte in diesem Jahr ein Eistag verzeichnet werden. Allerdings wurden, im Gegensatz zum Vorjahr, in Köln fünf Frosttage gemessen und in Warstein sogar mehr als doppelt so viele (elf). In Köln lag die Höchsttemperatur mit 16,2 °C in etwa auf dem Niveau des Wertes vom Februar 2024. In Warstein war die Tiefsttemperatur mit -4,8 °C fast drei Grad Celsius niedriger als letztes Jahr, die Höchsttemperatur mit 16,0 °C dagegen fast zwei Grad Celsius höher als im Februar 2024.
Wie gewohnt finden Sie alle Tabellen und Grafiken im vollständigen Witterungsverlauf.
Trotz Durchschnittlichkeit insgesamt wenig winterlich – der Winter 2024/25
Der Winter 2024/2025 war insgesamt zu warm, zu trocken und in Bezug auf die Sonnenscheindauer im Durchschnitt, wobei alle Werte letztlich wenig auffällig sind. So kann man durchaus von einem durchschnittlichen Winter, wie er in NRW inzwischen normal ist, sprechen. Das hat dann letztlich allerdings recht wenig mit einem klassischem Winterwetter zu tun. Schaut man ein wenig genauer hin, so war von allem etwas dabei, wobei Schnee in den Niederungen erneut eine Seltenheit blieb. Alle drei Monate Dezember, Januar und Februar waren wenig überraschend zu warm, insbesondere in Bezug auf die Referenzperiode 1961-1990, allerdings im Vergleich zur aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 waren der Januar und der Februar eher durchschnittlich. Beim Niederschlag sind die größten Abweichungen zu verzeichnen. Auffällig ist hier, dass der Dezember und der Februar zum Teil deutlich zu trocken waren, was in den vergangenen eineinhalb Jahren durchaus eine Seltenheit darstellt. Wenig Niederschlag spricht für viel Hochdruckwetter, im Winter ist dies jedoch kein Garant für viel Sonnenschein. So gab es vor allem im Dezember und Januar viele neblig-trübe Phasen; eine positive Abweichung konnte hier erst im Februar verzeichnet werden.
Die Wintermonate der Saison 2024/2025 fielen mit einer Durchschnittstemperatur von 3,2 °C überdurchschnittlich warm aus und das bereits im zwölften Jahr in Folge: der beobachtete Wert lag sowohl über dem der Referenzperiode 1961-1990 (Abweichung: +1,5 K) als auch dem der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 (Abweichung: +0,5 K). Damit ordnet sich dieser Winter im oberen Viertel der wärmsten Winter seit Aufzeichnungsbeginn 1881 ein.
Im Kontrast zum extrem nassen Winter 2023/2024 fiel in diesem Winter unterdurchschnittlich viel Niederschlag, nämlich lediglich 208 l/m². Dies ist insbesondere auf den recht trockenen Februar zurückzuführen. Das entspricht einer Abweichung vom Mittel der Referenzperiode (1961-1990: 223 l/m²) von -7 % sowie um -12 % von der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 (237 l/m²).
Insgesamt bewegten sich die Sonnenscheinstunden während der Wintermonate im durchschnittlichen Bereich. Mit einer Summe von 159 Sonnenscheinstunden schien die Sonne in NRW acht Stunden länger als im Referenzmittel 1961-1990 (151 h) und zugleich sechs Stunden weniger als im Mittel der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 (165 h).
Die milde Witterung dieses Winters wurde von nur kurzen kälteren Phasen durchbrochen, was dementsprechend zu einer moderaten Anzahl an kältebedingten Kenntagen führte. In Köln wurden von Dezember bis Februar zehn Frost- und kein einziger Eistag verzeichnet. In Warstein waren es 27 Frosttage und damit sogar fünf Frosttage mehr als im Vorwinter. Die Tiefsttemperatur des vergangenen Winters lag an der Kölner Station mit -2,9 °C rund 2 °C über dem Vorjahreswert, in Warstein hingegen fiel sie mit -8,0 °C sogar ca. 0,5 °C kälter aus. Die Höchsttemperatur erreichte in Köln mit 16,2 °C annähernd das Vorjahresniveau, in Warstein wurde dieses noch um rund 1,5 °C übertroffen.
Auch die Vergleichstabellen und Grafiken für den Winter 2024/2025 sind im vollständigen Witterungsverlauf zu finden.
Einblick
Aus dem LANUV wird zum 1. April 2025 das LANUK
Was bereits vor drei Jahren nach der letzten Landtagswahl im Koalitionsvertrag der Schwarz-Grünen Landesregierung festgehalten wurde, wird nun Realität. Damals entschied man sich im Zuge der Gründung des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) auch für die Einrichtung einer neuen Landesoberbehörde, dem Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung (LAVE). Das bedeutete gleichzeitig, dass der Verbraucherschutz seine bisherige Heimat, das LANUV, verlassen würde.
Zum 01.04.2025 wird das Gesetz zur "Neuordnung von Landesoberbehörden und zur Anpassung von Rechtsvorschriften für die Geschäftsbereiche des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr" nun in Kraft treten. Einige Teile des LANUV werden somit in das neue LAVE überführt. Währenddessen wird das ehemalige LANUV selbst unter dem neuen Namen „Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW“ (LANUK) firmiert. Zugleich wird der Nationalpark Eifel ins LANUK in die neue Abteilung 8 integriert.
Mit der Umbenennung sind einige Änderungen, wie geänderte Logos oder neue Mailadressen verbunden, so werden Sie uns ab April zum Beispiel unter der geänderten Funktionsadresse klimaatlas@lanuk.nrw.de erreichen. Darüber hinaus ändert sich für das Fachzentrum Klima NRW nichts. Allerdings freuen wir uns, dass das Klima "K" künftig im Namen des Landesamtes integriert sein und somit stärker zum Tragen kommen wird.
Rückblick auf die Mittelgebirgskonferenz 2025
Die Folgen des Klimawandels stellen uns überall vor Herausforderungen, die sich aber von Region zu Region unterscheiden können. In gebirgigen Regionen können sich bestimmte Folgen besonders intensiv auswirken. Die fünf Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen führten deshalb am 12. März 2025 die zweite gemeinsame Online-Konferenz zum Thema „Anpassung an den Klimawandel in Mittelgebirgen“ durch.
Die Vizepräsidentin des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Andrea Manz, begrüßte im Namen der fünf Bundesländer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz. Sie betonte, dass wir sowohl Klimaschutz umsetzen müssen, um uns vor noch schlimmeren Folgen des Klimawandels zu schützen, als auch die Anpassung an die jetzt schon unvermeidbaren Folgen des Klimawandels angehen müssen. Für diese Umsetzung sind die Kommunen ein zentraler Partner.
Am Vormittag fanden zwei parallele Themenworkshops statt: Einer zu Forstwirtschaft und einer zu Stadtgrün. Am Nachmittag fanden zwei weitere parallele Workshops zu den Themen Landwirtschaft und Schwammstadt statt. In den Workshops wurden jeweils vier kurze Impulsvorträge mit Umsetzungsbeispielen vorgestellt und im Anschluss Fragen dazu beantwortet und diskutiert.
Mit über 850 Anmeldungen war die Konferenz auch in diesem Jahr sehr gut besucht und über 60 % der Teilnehmenden haben sich an den Online-Diskussionen beteiligt. Die Konferenz zeigte das nach wie vor große Interesse an Informationen und Austausch zwischen Kommunen zur Klimaanpassung in Mittelgebirgsregionen. Die rege Beteiligung der Teilnehmenden an der Diskussion und dem Austausch deutet darauf hin, dass die vorgestellten Best-Practice-Beispiele gerne aufgegriffen werden und die Anregungen und Ideen aus den Impulsvorträgen nützlich waren. Wir können viel voneinander lernen und gute Ideen müssen weiterverbreitet werden. Und darin waren sich alle einig: Wichtige Voraussetzungen für gelingende Klimaanpassung sind ein langer Atem, Hartnäckigkeit, Kreativität und ein bisschen Optimismus. So sind wir der Klimaanpassung wieder einen kleinen Schritt nähergekommen.
Weitere Informationen zu den Inhalten der Themenworkshops finden Sie im vollständigen Bericht des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).
Neue Anwenderschulung zum Klimaatlas beim BEW in Essen terminiert
Am Dienstag, den 13. Mai 2025 wird die nächste Anwenderschulung zum Klimaatlas NRW wie gewohnt von 9:30 Uhr - 15:00 Uhr beim BEW in Essen stattfinden.
Dabei werden erneut die einzelnen Funktionen, Handlungsfelder und Tools des Klimaatlas sowie die damit verbundenen Möglichkeiten detailliert vorgestellt und anhand von praktischen Beispielaufgaben durch die Teilnehmenden angewendet.
Folgende Themenschwerpunkte werden im Rahmen des Workshops behandelt:
- Vorstellung und Erläuterung des Klimaatlas NRW
- Aufzeigen der Klimabeobachtungsdaten und Klimaprojektionen für NRW
- Nutzung der Kartenanwendung Klima NRW.Plus u. a. mit der Klimaanalyse, dem Gründachkataster NRW, der Starkregengefahrenhinweiskarte des BKG und der neuen luftbildbasierten Versiegelungskarte
- Darstellung und Erläuterung des Klimafolgen- und Anpassungsmonitorings NRW
- Vorstellung der Angebote der Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW
Die Schulung wendet sich in erster Linie wieder an Vertreterinnen und Vertreter der nordrhein-westfälischen Gebietskörperschaften – Städte und Gemeinden, Kreise, Bezirksregierungen, Regionalverbände und Regionalentwicklungsgesellschaften. Die Teilnahme für Personen von außerhalb der Gebietskörperschaften ist bei verfügbaren Plätzen möglich. Der Workshop ist wie immer kostenlos!
Die Anmeldung zur Anwenderschulung ist über diesen Link möglich. Nutzen Sie also die Chance den Klimaatlas NRW detailliert kennenzulernen!
Weitere Aktualisierungen im Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring
Wieder einmal möchten wir Sie an dieser Stelle auf die kürzlich aktualisierten Indikatoren des Klimafolgen- und Anpassungsmonitorings (KFAM) hinweisen.
Im Handlungsfeld "Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz" konnten drei weitere Indikatoren aktualsiert werden.
Diese sind:
- der Indikator 4.1 Standardisierter Niederschlagsindex (SPI)
- der Indikator 4.7 Gewässertemperatur fließender Gewässer und
- der Indikator 4.10 Wasserentnahme der öffentlichen Wasserversorgung
Zahlreiche weitere Indikatoren befinden sich gerade in der Aktualisierung und werden zeitnah freigeschaltet werden.
Stellenausschreibung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Das MUNV besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in der Abteilung 3 „Wirkungsbezogener und übergreifender Umweltschutz, Klima, Umweltbildung“ die Stelle einer Dezernentin / eines Dezernenten (w/m/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L).
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einem Stellenanteil von 0,75. Der Einsatz erfolgt im Fachbereich 34 „Übergreifende Umweltthemen, Landwirtschaft und Umwelt, Umweltinformation, nachhaltige Entwicklung“ am Dienstort Essen.
Folgende Punkt gehören zu den Aufgabenschwerpunkten:
- Koordination der Aktivitäten zur Nachhaltigkeits-, Umwelt-, und Klimaschutz-Berichterstattung in NRW
- Unterstützung des Berichtswesens zum Umsetzungsstand der Klimaneutralität in der Landesverwaltung
- Koordinierung und Unterstützung der kontinuierlichen Datenerhebung in den oben genannten Bereichen z. B. durch Schulungen, Sprechstunden, Erfassungsanleitungen, FAQ-Dokumente
- Qualitätskontrolle, Lückenmodellierung sowie Hochrechnungen
- Aufbereitung von Daten in ansprechender und leicht verständlicher Form
- Analyse und Bewertung der gesammelten Informationen
- Erstellung von Berichten mit aussagekräftigen Grafiken und erläuternden Texten
- Weiterentwicklung des standardisierten Berichtssystems zu den Treibhausgas-Emissionen der Landesverwaltung nach einschlägigen Normen (z.B. ISO 14046 und GHG-Protocol)
- Fachliche Beratung der Geschäftsstelle Klimaneutrale Landesverwaltung im MWIKE zur Berichterstattung für die Klimaneutrale Landesverwaltung NRW
- Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Klimaneutralität
- Vorbereitung und Vergabe von Aufträgen an Dritte sowie Steuerung der Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer
- Organisation und Durchführung von Sitzungen, Workshops und Veranstaltungen sowie Vortragstätigkeit zur Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkommunikation
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen und vollständigen Unterlagen (u.a. Lebenslauf, Zeugnis über die Hochschulvor- und -abschlussprüfung, bei Beamten/-innen aktuelle dienstliche Beurteilung, ansonsten aktuelles Arbeits-/Zwischenzeugnis, Nachweise über Anerkennungen ausländischer Bildungsabschlüsse, Nachweise über berufliche Tätigkeiten, ggf. Diploma Supplement, Transcript of Records, Akkreditierung bei FH-Abschlüssen, Übersetzungen) senden Sie bitte bis zum 24.04.2025 (Eingang bei der Dienststelle) per E-Mail oder auf dem Postweg. Bewerbungen per E-Mail richten Sie bitte an bewerbung@munv.nrw.de.
Alle weiteren wichtigen Informationen erhalten Sie in der vollständigen Stellenausschreibung.
Rundblick
Natürlicher Klimaschutz in Kommunen: Neustart und Erweiterung des BMUV-Förderprogramms
Das Bundesumweltministerium und die KfW setzen die im vergangenen Jahr im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) gestartete und stark nachgefragte Fördermaßnahme "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" (NKK) fort. Neu hinzugekommen ist die Finanzierung von Entsiegelungsmaßnahmen zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen.
Kommunen erhalten im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) ab sofort wieder Zuschüsse von bis zu 90 Prozent der Finanzierungskosten für Grünanlagen wie Baumpflanzungen oder die Anlage kleiner, naturnaher Parkflächen sowie Naturerfahrungsräumen und urbanen Wäldern. Gefördert werden auch die Umstellung auf ein naturnahes Grünflächenmanagement und die Renaturierung innerörtlicher Kleingewässer.
Neu hinzugekommen ist die Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen und die Erstellung kommunaler Entsiegelungskonzepte. Die Förderung von Entsiegelungskonzepten für bebaute Räume soll die vorhandenen Potenziale zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen erschließen. Auf diese Weise werden Kommunen bei gezielten Maßnahmen zur Steigerung der Biotop- und Artenvielfalt sowie des Wasserrückhalts in unseren Städten und Gemeinden unterstützt. Gleichzeitig sollen Hitzestress sowie Lufttrockenheit im Siedlungsraum anhaltend reduziert werden.
Für 2025 stehen für das neue Förderfenster insgesamt 178 Millionen Euro bereit, davon etwa 33 Millionen Euro für Entsiegelungsmaßnahmen und -konzepte. Im vergangenen Jahr ist bereits eine Vielzahl von Projekten im Rahmen dieses Programms bewilligt worden.
Weitere Informationen zum Förderprogramm NKK finden Sie in unserem Förder-Navi. Wer sich einen Überblick über das Entsiegelunsgpotenzial innerhalb seiner Kommune verschaffen möchte, für den lohnt ein Blick in die luftbildbasierte Versiegelungskarte im Klimaatlas.
Genehmigung für größte Hochwasserschutz-Maßnahme: Gesteuerter Überflutungsraum bei Köln-Worringen entlastet am Rhein
Mit der geplanten Maßnahme sollen mehrere Zehntausend Menschen im Kölner Norden bei Hochwasser geschützt werden. Zudem schafft sie Entlastung für alle, die unterhalb von Köln-Worringen am Rhein zu Hause sind: Am Freitag den 14. März 2025 überreichte Umweltminister Oliver Krischer den Genehmigungsbescheid für den Retentionsraum Worringen an Ulrike Franzke, Vorständin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln). Die künstlich geschaffene Überschwemmungsfläche soll bei Hochwasser bis zu 30 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen und damit Hochwasserspitzen am Rhein um bis zu 17 Zentimeter kappen. Dafür werden umgrenzende Bauwerke geschaffen, die ein kontrolliertes Fluten und später wieder Ablassen des Wassers auf einer Fläche von insgesamt 670 Hektar ermöglichen.
Der Retentionsraum soll künftig geflutet werden, wenn am Kölner Pegel eine Höhe von mindestens 11,70 Meter erreicht ist und eine Hochwasserwelle von mehr als 11,90 Metern prognostiziert wird. Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln als Maßnahmenträger beginnen nun mit der detaillierten Ausführungsplanung und der Vergabe der Bauleistungen, die ab 2027 bis 2034 stattfinden sollen. Das Land leistet neben dem Bund einen erheblichen Anteil an der Finanzierung, sowohl zur Ertüchtigung des Rheindeichs zwischen Worringen und Chorweiler als auch für den Bau des dahinter liegenden Retentionsraums. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach derzeitigem Stand 226 Millionen Euro.
Onlinekurs für Kommunalverwaltungen: Wuppertal Institut veröffentlicht kostenfreies E-Learning für die nachhaltige Gestaltung lebenswerter Straßen
Wie gelingt es, die heutigen Stadtstraßen nachhaltig und zukunftssicher umzubauen und daraus (wieder) lebenswerte öffentliche Räume zu entwickeln? Konkrete Antworten auf diese Frage bietet der neue Onlinekurs „Zukunftsfähige Quartiere durch lebenswerte Straßen“, den das Wuppertal Institut Anfang März veröffentlicht hat. Der kostenfreie Kurs richtet sich vor allem an Mitarbeitende von Kommunalverwaltungen, aber auch an alle anderen Interessierten. Er ist auf der Bildungsplattform Twillo über den untenstehenden Link zugänglich.
Die Kursinhalte basieren auf Projektarbeiten des Wuppertal Instituts, der MUST Städtebau GmbH, der Zukunftsinitiative Klima.Werk/EGLV und des Urban Participation Lab. Im vom Ministerium für Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW (MUNV) geförderten Projekt “LesSON” entwickelten die Forschenden in einem breit angelegten Beteiligungs- und Planungsprozess innovative Entwürfe für zwei Straßenzüge in Dortmund und Gelsenkirchen. Anschließend begleitete das Projektteam sieben weitere Kommunen in NRW vor Ort bei konkreten Projekten im Straßenraum. Die zahlreichen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis hat das Projektteam nun als Onlinekurs aufbereitet: In insgesamt sechs Modulen erhalten die Teilnehmenden nicht nur einen Überblick zum Konzept lebenswerter Straßen, sondern auch vertiefende Einblicke in verschiedene Teilaspekte. So thematisiert ein Modul beispielsweise die Notwendigkeit der Neuaufteilung des Straßenraums aus Sicht der Klimaanpassung, ein anderes Modul behandelt die Eignung bestimmter Beteiligungsformate im Planungsprozess. Zudem beleuchtet der Onlinekurs die Bedeutung von Visualisierungen und Straßenexperimenten für den Umbau von Quartiersstraßen – und regt zur kritischen Reflexion an, inwieweit bestehende Verwaltungsstrukturen den Stadtumbau begünstigen oder hemmen.
Die einzelnen Module enthalten sowohl die vom Projektteam aufbereiteten Erkenntnisse aus fast fünf Jahren praxisnaher Forschung als auch Diskussionen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis – und damit auch externe Expertise und Erfahrungen, etwa aus einem Projekt in der Münchner Kolumbusstraße oder dem BlueGreenStreets-Projekt der HafenCity Hamburg.
Der Kurs ist kostenfrei. Die Erstellung des Onlinekurses wurde vom MUNV gefördert.
Weitere Informationen finden Sie online:
Zum Onlinekurs auf der Bildungsplattform Twillo
Zur LesSon-Projekthompage und zum Projektflyer
Vorstellung des Forschungsberichts "BlueGreenStreets 2.0: implementieren, evaluieren, verstetigen"
Am 14. Februar 2025 wurde auch der umfassende Forschungsbericht "BlueGreenStreets 2.0: implementieren, evaluieren, verstetigen" veröffentlicht. Diese Arbeit, verfasst von einem interdisziplinären Team der HCU Hamburg, bietet eine detaillierte Anleitung zur klimafreundlichen Straßengestaltung und stellt die neue Toolbox 2.0 vor. Diese Toolbox ist das Ergebnis intensiver Forschung und praktischer Tests in verschiedenen deutschen Städten und bietet sowohl theoretische als auch praktische Unterstützung für Kommunen und Planer.
Der Bericht gliedert sich in fünf Hauptteile: von der Einführung in die Konzepte von BlueGreenStreets über den Praxis-Check in Pilotkommunen bis hin zu spezifischen Planungshilfen und einem Ausblick für die Zukunft. Besonders hervorzuheben ist die Anwendung in den Städten Lübeck und Potsdam, wo die BGS-Prinzipien konkret in der Straßenplanung umgesetzt und evaluiert wurden. Diese Erfahrungsberichte bieten wertvolle Erkenntnisse für andere Städte, die ähnliche Projekte in Betracht ziehen.
Ein zentrales Element der Toolbox 2.0 ist die Planungshilfe zur wassersensiblen Straßengestaltung, die darauf abzielt, urbane Straßen widerstandsfähiger gegen extreme Wetterbedingungen zu machen. Ergänzt wird dies durch neue Ansätze zur Gestaltung vitaler Baumstandorte, die eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung fördern. Der Bericht schließt mit einem Ausblick, der die Herausforderungen und Chancen für die künftige Entwicklung von BlueGreenStreets aufzeigt und zur stärkeren Integration dieser Ansätze in die politische und planerische Praxis aufruft.
Interessierte können den vollständigen Bericht hier abrufen.
Zwei neue Publikationen des Umweltbundesamtes zur Klimaanpassung veröffentlicht
Das Umweltbundesamt (UBA) hat ebenfalls im Februar zwei neue Publikationen mit Klimawandel- bzw.Anpassungsbezug veröffentlicht.
Schäden des Klimawandels schätzen: Konzept für nationales Schadenskataster
Informationen über vergangene und zukünftige Klimawandel-bedingte Schäden bilden eine wichtige Grundlage für einen strategischen und effektiven Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Bisher existiert in Deutschland noch kein nationales Monitoringprogramm, das solche Schäden systematisch erfasst. Die vorliegende Studie adressiert diese Lücke und entwickelt erste Empfehlungen für eine zeitnahe Umsetzung eines nationalen Schadenskatasters.
Der Abschlussbericht der Studie, die von INFRAS in Kooperation mit Adelphi erarbeitet wurde, finden Sie hier.
Ausgaben des Bundes für die Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Pilotierung einer Analysemethodik
Anpassung an die Folgen des Klimawandels betrifft viele Politikfelder. Doch wie viel der Bund für Anpassungsaktivitäten vorsieht, war bisher unbekannt. Mit einer neuen Methodik des Umweltbundesamts lassen sich die Ausgaben schätzen. Eine erste Auswertung zum Bundeshaushaltsplan 2022 zeigt: In 255 Haushaltstiteln waren zwischen 2,1 Mrd. Euro und 3,4 Mrd. Euro für die Anpassung eingestellt.
Diese, ebenfalls von Adelphi und INFRAS erarbeitete Studie kann hier heruntergeladen werden.
KLUG veröffentlicht neuen Musterhitzeschutzplan für den Rettungsdienst
Der Klimawandel führt zu immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen – eine Herausforderung nicht nur für die allgemeine Bevölkerung, sondern insbesondere auch für die Rettungsdienste. Um Rettungskräfte bei der Bewältigung dieser zunehmenden Belastung zu unterstützen, hat die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) gemeinsam mit der AG Rettungsdienst von KLUG einen praxisorientierten Musterhitzeschutzplan für den Rettungsdienst entwickelt.
Hintergrund: Hitzewellen stellen eine wachsende gesundheitliche Bedrohung dar und führen zu einer erhöhten Zahl von Notfalleinsätzen, insbesondere für besonders vulnerable Gruppen. Gleichzeitig sind Rettungskräfte selbst einem hohen Risiko ausgesetzt – lange Einsätze in großer Hitze, körperliche Anstrengung und belastende Schutzkleidung können ihre eigene Gesundheit gefährden.
Ziel: Mit dem Musterhitzeschutzplan werden konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben, um sowohl Einsatzkräfte als auch Patientinnen und Patienten besser zu schützen.
Der Musterhitzeschutzplan wird u.a. vom Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin der Uniklinik Freiburg, der Uniklinik der RWTH Aachen, dem Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. unterstützt.
Hier gehts zum Download.
Ergebnisse des Forschungsprojektes "Strategien für klimagerechte Dachflächen"
Der Bundesverband Gebäudegrün e. V. (BuGG) und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) haben das vom BBSR im Förderprogramm ZukunftBau geförderte Projekt "Strategien für klimagerechte Dachflächen" abgeschlossen.
Das Projekt stellt bereits vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse zur Eignung und Nutzung von Photovoltaik (PV) und Dachbegrünungen zusammen, einschließlich kombinierter Systeme PV und Gründach. Darauf aufbauend wird der Zwiespalt der beiden Nutzungsformen sowie der jeweiligen energetischen, ökologischen und ökonomischen Vor- und Nachteile für die Gebäude und Stadtquartiere diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf gebäudeübergreifenden Strategien (Mikro- und Makroperspektive) sowie dem Umgang mit Bestandsgebäuden. Denn eine starke Verbreitung von Photovoltaik und/oder Dachbegrünung im Stadtgebiet wirkt sich zum Teil weit über die Gebäudeebene und die Effekte von Einzelinstallationen hinaus aus.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projekthomepage und in der veröffentlichten BBSR-Online-Publikation.
Ausblick
ZKA Spezial: Klimaangepasste Gebäude: Vorsorgen für Hitze und Starkregen am 08. April 2025, online
Hitze und Starkregen führen schon heute sowohl zu Schäden an Gebäuden und Inventar als auch zu gesundheitlichen Belastungen. Letzteres gilt für Bewohnerinnen und Bewohner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für Besucherinnen und Besucher. Um sich gegen die zunehmenden Folgen des Klimawandels zu wappnen, gilt es, das Nutzungsverhalten, den Gebäudezustand sowie Möglichkeiten der Maßnahmen an Gebäuden in den Blick zu nehmen. Welche Bedeutung haben naturbasierte Lösungen? Und welche Herausforderungen und Chancen begegnen Kommunen und sozialen Trägern auf dem Weg zur Umsetzung?
Das Zentrum KlimaAnpassung richtet zu diesen und weiteren Fragen am Dienstag, den 08. April 2025, von 10:00 – 12:30 Uhr einen Workshop aus. Gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten sollen Klimaanpassungsmaßnahmen am Gebäude vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen Schritte der Umsetzung aufgezeigt werden. Neben Impulsvorträgen aus der Praxis bietet die Veranstaltung Raum für aktiven Austausch untereinander. Bringen Sie gerne Ihre Fragen und Erfahrungen mit ein.
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.
NKU-Sprechstunde „Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel und ihre Bedeutung für Unternehmen" am 10. April 2025, online
Der Klimawandel ist längst Realität und bringt auch für Unternehmen spürbare Herausforderungen mit sich – von extremen Wetterereignissen bis hin zu regulatorischen Anforderungen. Um Deutschland widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen, hat die Bundesregierung die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) formuliert. Sie setzt den Rahmen für eine systematische und vorausschauende Anpassung in verschiedenen Sektoren – auch in der Wirtschaft. Unternehmen sind dabei sowohl Betroffene als auch Akteure. Sie müssen Risiken bewältigen, können aber zugleich durch strategische Anpassungsmaßnahmen langfristige Chancen nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Die 29. Sprechstunde des Netzwerks Klimaanpassung und Unternehmen (NKU), die am 10. April 2025 obligatorisch von 8:00 - 8:45 Uhr stattfindet, widmet sich diesem Thema mit folgenden Fragen:
- Welche Rolle spielen Unternehmen in der Deutschen Anpassungsstrategie, und welche Erwartungen gibt es an die Wirtschaft?
- Welche klimabedingten Risiken sollten Unternehmen bereits heute in ihre Planungen einbeziehen?
- Welche Unterstützung bietet die Politik, um Unternehmen bei der Klimaanpassung zu begleiten?
- Wie kann frühzeitige Anpassung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen
Zu Gast ist Lars Oberg, Referatsleiter für Grundsatzfragen des Klimaschutzes in der Industrie im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).
Hier können Sie sich für die Sprechstunde anmelden.
Zukunftsgewässer NRW: Kooperation Überflutungsvorsorge an Agger und Wupper am 30. April 2025, online
Die Kooperation „Überflutungsvorsorge an Agger und Wupper“ hat das Ziel, Maßnahmen und Lösungen zu erarbeiten, die dem vorsorgenden Hochwasser- und Starkregenschutz dienen. Dabei möchten die Kooperationspartner über ihre Grenzen hinweg interkommunal zusammenarbeiten und so Ressourcen bündeln, Fachwissen teilen und Synergien nutzen.
Damit werden weitergehende Hilfestellungen, sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für die zukunftsorientierten planerischen Prozesse der Städte und Gemeinden zur Risikoreduktion geschaffen und gefördert.
In diesem Impuls des Projektes Zukunftsgewässer NRW am 30. April 2025 von 9:00 - 10:30 Uhr wird Ihnen die Kooperation durch Sinja Lütz näher vorgestellt.
Die Teilnahme ist wie immer kostenlos und ohne Anmeldung möglich, den Teilnahmelink finden Sie hier.
Klima und Starkregen - Strategien und Herausforderungen: Neue BEW-Seminarreihe im Mai, Präsenz in Essen und online
Die Auswirkungen des Klimawandels sind zunehmend spürbar, besonders Starkregenereignisse treten häufiger auf und stellen Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Wie können wir uns also auf diese Extremwetterereignisse vorbereiten? Welche Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge sind bereits erfolgreich im Einsatz? Und welche neuen technologischen Entwicklungen gibt es, um solche Ereignisse besser vorherzusagen?
Diesen Fragen widmet sich die neue BEW-Seminarreihe: Klima und Starkregen.
Erfahren Sie in der Präsenz-Auftaktveranstaltung
Starkregen und Überflutungsvorsorge – Extremwetter im Klimawandel
wie Städte sich vor Starkregen schützen können, welche Lösungen das Klima.Werk entwickelt und wie künstliche Intelligenz (KI) die Vorhersage von Starkregen und Sturzfluten verbessert. Den Abschluss bildet eine spannende Podiumsdiskussion mit den Experten/-innen, darunter der Klimaexperte Frank Böttcher, bei der Sie Ihre Fragen stellen und sich mit Fachleuten austauschen können.
BEW-Essen: 08.05.2025, 09:00-16:30 Uhr
Die folgenden Online-Termine der Seminarreihe widmen sich einzelnen Themen im Detail. Lernen Sie im Online-Seminar
KI und Simulation in der Hochwasservorsorge und Stadtplanung
wie künstliche Intelligenz und Simulationen dabei helfen, Hochwassergefahren frühzeitig zu erkennen, Risiken besser einzuschätzen und Städte vorausschauend zu planen.
Online: 13.05.2025, 09:00-13:00 Uhr
Im zweiten Online-Seminar
Kommunale Strategien für Starkregenereignisse: Recht, Risiko und Kommunikation
erhalten Sie wertvolle Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen sowie effektive kommunikative und risikobasierte Ansätze für den Umgang mit Starkregenereignissen.
Online: 14.05.2025, 09:00-13:00 Uhr
Zum Abschluss der Seminarreihe erfahren Sie in der Online-Veranstaltung
Resiliente Städte: Schwammstadt-Prinzip, Baumversorgung und Starkregenvorsorge
wie das Schwammstadt-Prinzip und eine gezielte Baumversorgung dazu beitragen, Städte klimaresilienter zu machen und besser auf Starkregenereignisse vorzubereiten.
Online: 15.05.2025, 09:00-13:00 Uhr
Melden Sie sich jetzt an und buchen Sie die gesamte Veranstaltungsreihe zu attraktiven Kombipreisen. Jede Veranstaltung ist auch einzeln buchbar.
Bundeskongress Zukunftsfähige Schulgelände am 14. und 15. Mai 2025 in Berlin
Die Deutsche Umwelthilfe veranstaltet am 14. und 15. Mai in Berlin und am 22. Mai 2025 online den Bundeskongress Zukunftsfähige Schulgelände.
Viele Schulgelände in Deutschland wurden in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts geplant und sind von großen Beton- und Asphaltflächen bestimmt. Doch auch auf neu geplanten Schulgeländen dominieren oft versiegelte Flächen. Der Klima- und Biodiversitätskrise sowie den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen, die zunehmend mehr Zeit auf dem Schulgelände verbringen, wird eine solche Gestaltung nicht gerecht. Doch wie ist ein Zukunftsfähiges Schulgelände gestaltet? Dieser Frage will die Deutsche Umwelthilfe beim Bundeskongress Zukunftsfähige Schulgelände anhand von vier Fokusbereichen nachgehen:
- Klimaanpassung und Biodiversität
- Gesundheit und Umweltgerechtigkeit
- Politischer Rahmen und Strukturen
- Praktische Umsetzung
Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der Veranstaltungsseite.
Copernicus im Einsatz: Planung und Steuerung einer klimaresilienten Stadtentwässerung und Wasserwirtschaft am 03. und 04. Juni 2025 beim RVR in Essen
Das Copernicus Netzwerkbüro Kommunal möchte am 03. und 04. Juni 2025 mit einem Workshop die kommunalen Fachbehörden sowie weitere Akteure der kommunalen Ebene (Stadtwerke, Unternehmen, Forschungseinrichtungen etc.) erreichen und einbinden. Es gilt, gemeinsam Aufgaben, Bedarfe und Fragestellungen in diesem Themenfeld zu identifizieren und zu erarbeiten, wie diese mit Fernerkundung und Copernicus unterstützt werden können. Am 03. Juni geht es beim RVR in Essen zunächst von 13:00 - 17:00 Uhr um das Thema "Planung" und am 04. Juni von 08:30 - 12:00 Uhr um "Monitoring & (Anlagen-)Steuerung".
Hintergrund: In Zeiten verstärkt auftretender Starkregenereignisse sehen sich Kommunen mit neuen und zunehmenden Herausforderungen im Bereich der Stadtentwässerung konfrontiert. Häufigere und intensivere Regenfälle überlasten bestehende Entwässerungssysteme und führen zu Überschwemmungen, die sowohl infrastrukturelle Schäden als auch Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit mit sich bringen. Kommunen müssen daher ihre Herangehensweise und Entwässerungssysteme an die veränderten klimatischen Bedingungen anpassen, um den Schutz der Bevölkerung und der städtischen Infrastruktur zu gewährleisten.
Der Workshop soll spezifische kommunale Aufgaben der Stadtentwässerung thematisieren und aufzeigen, welche Herausforderungen sich in Zeiten des Klimawandels zunehmend ergeben. Behandelt werden sollen u. a.
- Starkregen- und Hochwassermanagement
- Retention
- Kanalnetzdimensionierung
- Kläranlagen- und Entwässerungssteuerung
- Infrastrukturplanung
Hier gelangen Sie zur Anmeldung.
Save the Date: Klimawandelanpassung im Blick - welche Fortschritte machen wir? am 16. und 17. September 2025 in Dessau
Im Umweltbundesamt findet im Rahmen der diesjährigen Woche der Klimaanpassung (15.-19. September) am 16. und 17. September eine zweitägige Fachkonferenz mit dem Titel "Klimawandelanpassung im Blick - welche Fortschritte machen wir?" statt.
Der Klimawandel schreitet schneller voran als erwartet. Seine Folgen werden intensiver und häufiger gespürt. Kommunen, Länder, Bund, die Europäische Kommission und Gremien der Klimarahmenkonvention arbeiten daran, diesem Trend mit Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel entgegen zu wirken. Doch wie genau wirken diese Anpassungsmaßnahmen? Wie können ihre Auswirkungen bewertet werden? Was sind Anpassungsfortschritte und wie werden sie erfasst? Und wie können diese Informationen künftiges Anpassungshandeln sowie die Kommunikation unterstützen?
Die UBA-Fachkonferenz bietet neueste Forschungsergebnisse zu den aufgeworfenen Fragen. Es besteht Gelegenheit, diese mit Praxisakteuren zu diskutieren und Schlussfolgerungen u.a. zu Wirkungsmessung und Indikatorenentwicklung für die eigene Facharbeit abzuleiten.
Informationen zu Programm und Anmeldung folgen in Kürze.
Bereits jetzt können Sie sich unter uba-fortschrittserfassung@e-fect.de in den Verteiler für die Konferenzeinladung eintragen lassen.